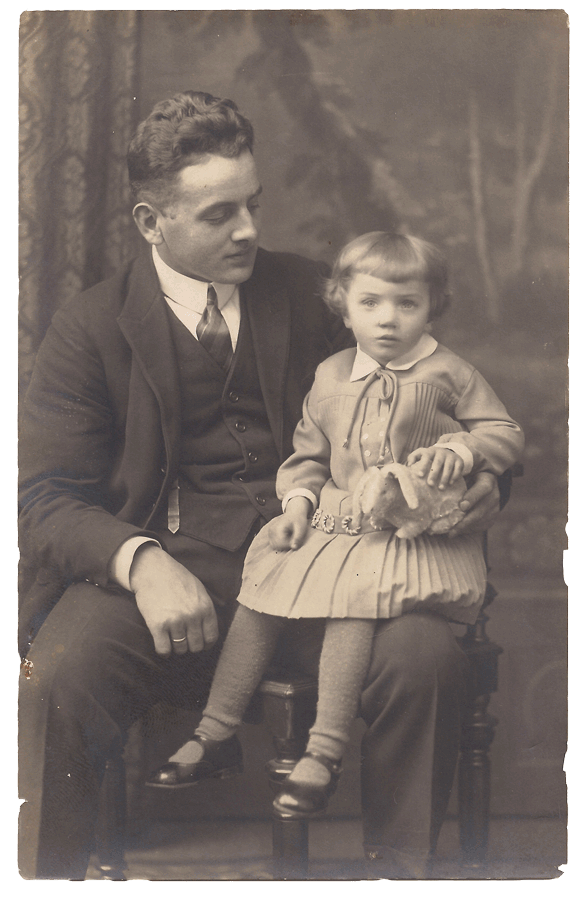Die 1975 angelegte Kriegsgräberstätte auf dem Friedhof der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg umfasst heute 84 Gräber, davon 80 für Erwachsene und vier für Kinder. Unter den Erwachsenen waren 24 Frauen und 56 Männer im Alter von 17 bis 88 Jahren. Das Durchschnittsalter der Beerdigten betrug 30 Jahre bei den Frauen und 35 Jahre bei den Männern. Mit einer Ausnahme waren alle Toten Patient*innen der Heil- und Pflegeanstalt. Sie starben zwischen 1922 und 1950 und kamen aus Polen (29), Russland (20), Ukraine (10), Lettland (5), Rumänien (2), Serbien (2), Slowenien (2), Belgien (1), Griechenland (1), Italien (1), Niederlande (1), Spanien (1) und Ungarn (1). Die Herkunft von vier Toten ist unbekannt.
Bei den Toten handelt es sich um ausländische Zwangsarbeiter*innen, Kriegsflüchtlinge, »Umsiedler*innen« und solche, deren Staatsbürgerschaft nicht eindeutig geklärt ist. 21 der hier liegenden Toten starben an Hunger und Erschöpfung. In 34 der Gräber wurden Patient*innen bestattet, die an Tuberkulose gestorben waren. In zehn Gräbern ruhen Erkrankte, die aus der Heil- und Pflegeanstalt Oldenburg in Wehnen am 14. Dezember 1944 nach Lüneburg verlegt wurden. Sie wurden kaum untersucht, starben ebenfalls zumeist an Hunger und Erschöpfung. Zur Anlage gehören auch 19 Gräber von Menschen, die an »Altersschwäche«, Lungenentzündung, Mohnvergiftung und infolge von Dauerkrampf oder einer Operation starben.
Die Gräber von Kindern, die in der »Kinderfachabteilung« der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg Patient*innen waren, wurden ab Mitte der 1970erJahre aufgelöst. Nur die Gräber von Dieter Lorenz, Berend – Benni – Hiemstra, Rosa Reinhard und Abraham Kamphuis sind erhalten geblieben. Abweichend vom Kriegsgräbergesetz von 1952, durch das Gräber ausländischer Kinder nicht explizit geschützt wurden, hatte die Friedhofsverwaltung diese und zwei weitere Gräber 1954 bzw. 1957 auf die Kriegsgräberliste gesetzt.
Sieben Kindergräber wurden bei der Anlage der Kriegsgräberstätte 1975 nicht berücksichtigt:
Bernd Sabarosch (1944 – 1945, Holland)
Luba Gorbatschuk (1943 – 1944, unbekannt)
Ilja Matziuk (1944 – 1945, unbekannt)
Elisabeth van Molen (1943 – 1944, Holland)
Johann Peter Wolf (1932 – 1942, Holland)
Uossy bzw. Kossi (… – 1945, unbekannt)
Yvonne Mennen (1938 – 1944, Holland)
Die Gräber von Ilja Matziuk und Luba Gorbatschuk, zwei Mädchen von Zwangsarbeiterinnen, wurden 1975 überbettet, obwohl sie gemäß Ministerialerlass von 1966 geschützt waren. Elisabeth van Molens Grab ist zuletzt in der Kriegsgräberliste von 1958 erwähnt. Johann Peter Wolfs Grab wurde 1975 noch in die Planung der Kriegsgräberstätte einbezogen. Beide wurden nicht umgebettet.