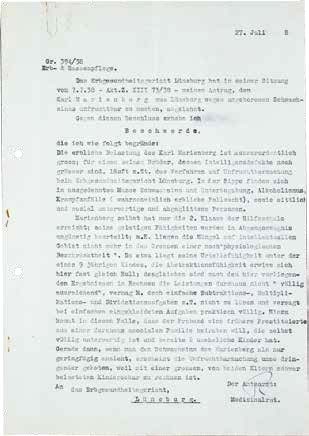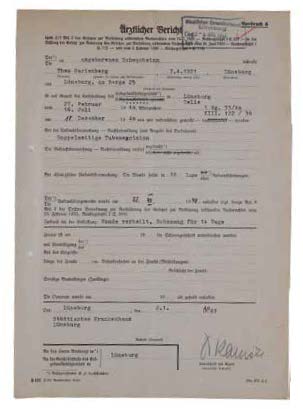Viele Zwangsarbeiter*innen erkrankten psychisch infolge von schwerer körperlicher Arbeit, Mangelernährung, desolater Unterbringung sowie Gewalterfahrungen. Sofern eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde – etwa durch eine*n Lagerarzt/-ärztin oder durch die*den Amtsarzt/-ärztin, konnten die Patient*innen fachmedizinisch behandelt und in die Psychiatrie eingewiesen werden.
Mit dem rasanten Anstieg der Zahl der Zwangsarbeiter*innen aus West- und Osteuropa 1943 stieg auch die Anzahl der Patient*innen, die eine psychiatrische medizinische Versorgung benötigten.
Um die Zwangsarbeiter*innen von den regulären Anstaltspatient*innen zu separieren, wurden entsprechende Stationen bzw. »Ostarbeiter«-Abteilungen eingerichtet. Diese Separierung hatte mehrere Gründe. Zum einen sollten Infektionsketten unterbrochen werden, da Zwangsarbeiter*innen infolge katastrophaler hygienischer Bedingungen in ihren Unterkünften neben ihrer psychiatrischen Diagnose vermehrt an ansteckenden Erkrankungen litten, etwa Tuberkulose. Zum anderen ermöglichte die Separierung eine strukturell angelegte Mangelversorgung und -ausstattung. Außerdem sollten deutsche Patient*innen vor den Zwangsarbeiter*innen »geschützt« bleiben, somit diente die Separierung auch der Isolierung der als kulturell und rassisch »minderwertig« geltenden osteuropäischen Patient*innen.
1944 entschied das Reichministerium des Innern sogenannte »Ausländersammelstellen« in elf Heil- und Pflegeanstalten auf dem Gebiet des Deutschen Reiches einzurichten. Im September 1944 wurde die Anordnung umgesetzt. Viele Psychiatriepatient*innen ausländischer Herkunft, die in diesen Sammelstellen konzentriert wurden, wurden Opfer der »Euthanasie«.